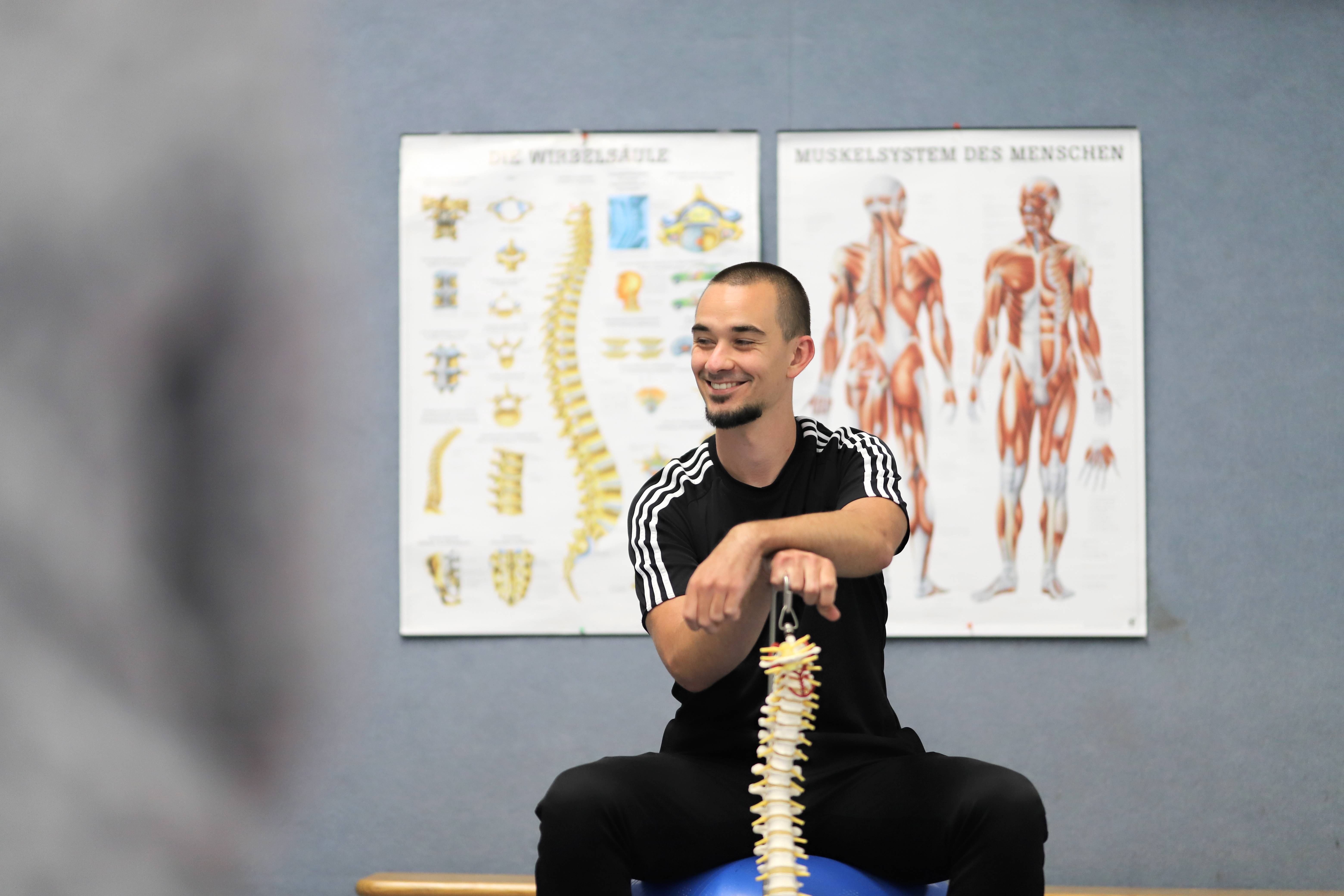Regelmäßiger Gebrauch von Schmerzmittel kann zu Gewohnheit und Abhängigkeit führen / Paracelsus Wiehengebirgsklinik Bad Essen bietet kombinierte „Integrierte Suchtmedizinische und orthopädische Rehabilitation (ISOR)“ für chronische Schmerzpatienten an
Wenn der Rücken schmerzt, geht nichts mehr – keine Arbeit, kein Haushalt, manchmal nicht einmal mehr das Aufstehen. Ob Muskelverspannungen, Bandscheibenprobleme oder Osteoporose – der schnelle Griff zur Salbe oder Schmerztablette hilft in solchen Fällen vielen, aber er hat auch seine Tücken. Denn wenn die Schmerzen chronisch werden und die Schmerztabletten zur Dauermedikation, steigt auch das Risiko der Gewöhnung und Abhängigkeit. „Problematisch ist es immer dann, wenn Betroffene Schmerzmittel ohne ärztliche Begleitung dauerhaft in immer höheren Dosen oder immer stärkeren Varianten einnehmen“, erläutert Dr. med. univ. Christoph Bätje, Chefarzt der Paracelsus Wiehengebirgsklinik Bad Essen. „Denn der Übergang von der Gewöhnung an frei erhältliche Schmerzmittel bis zur Sucht ist fließend und wird, wenn überhaupt, erst sehr spät bemerkt. Patienten werden psychisch, je nach Medikament sogar körperlich abhängig und es ist unbedingt professionelle Hilfe notwendig. ”
Etwa 17% aller Deutschen sind nach Zahlen der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. von langanhaltenden, chronischen Schmerzen betroffen – insgesamt mehr als 12 Millionen Menschen. Etwa 1,6 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren sind sogar abhängig von Schmerzmedikamenten – zu diesen Ergebnissen kommt der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) aus dem Jahr 2018. Das entspricht verglichen mit den Daten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen der Zahl alkoholabhängiger Menschen in Deutschland.
Wie Schmerzmittel wirken
Um zu verstehen, warum Schmerzmittel abhängig machen können, hilft ein Blick auf ihre Wirkungsweise. Sie sind nicht nur unterschiedlich stark, haben als Salbe, Tablette, Saft oder Pflaster verschiedene Formen, sondern sie bekämpfen den Schmerz auch an unterschiedlichen Stellen. Während die einen den Schmerz punktuell da stoppen, wo er entsteht, können andere auch den Weg des Schmerzimpulses über die Nervenbahnen zum Gehirn unterbrechen. Wieder andere – vor allem die Opioide – wirken direkt auf die Schmerzrezeptoren im Gehirn. „Schmerz ist immer eine Kopfsache. Im Gehirn werden die Reaktionen ausgelöst, die uns Schmerz empfinden lassen und die uns sagen, wie wir uns verhalten sollen“, erklärt Dr. Bätje. „Manchmal übernimmt unser Gehirn auch selbst die Regie. Es behält den Schmerz im Gedächtnis, kann uns psychisch sagen, dass wir Medikamente unbedingt brauchen und verlangt nach stärkeren Mitteln.” Wie bei anderen Drogen brauchen Abhängige dann regelmäßig immer wieder Schmerzmitteln bzw. mehr und stärkere Schmerzmittel. Sind sie legal nicht zu bekommen, kommt oft Alkohol ins Spiel, um die Situation in den Griff zu bekommen – ein Teufelskreis in die Abhängigkeit beginnt.
ISOR-Behandlung verbindet Suchtbehandlung und Orthopädie
„Viele Patienten, die zu uns in die Paracelsus Wiehengebirgsklinik Bad Essen kommen, haben diese Kombination von Schmerzen, Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit“, so Dr. Bätje, „Wir versuchen hier die Verkettung aufzubrechen und haben dazu ein eigenes Behandlungsprogramm entwickelt. ISOR, so heißt das Programm, ist in seiner Form einzigartig in Deutschland und verbindet Suchtmedizin und Orthopädie miteinander. Hauptzielgruppe sind suchtmittelabhängige Menschen in der zweiten Lebenshälfte mit chronischen Rückenschmerzen.“ In der Klinik, die mit 146 Behandlungsplätzen auf die stationäre Entwöhnungsbehandlung von stoffgebundenen Abhängigkeiten spezialisiert ist, sind derzeit 24 Behandlungsplätze für die „Integrierte Suchtmedizinische und Orthopädischen Rehabilitation“ – kurz ISOR – reserviert. „Wir wollen mit dem Angebot die Menschen wieder in ein selbstbestimmtes, suchtfreies Leben ohne Schmerzen führen“, erläutert der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. „Der Aufenthalt bei uns dauert in der Regel 16 Wochen und setzt auf ein intensiviertes Bewegungsangebot und eine Verbesserung der seelischen und körperlichen Leistungsfähigkeit, wobei die psychotherapeutische Suchtbehandlung klar im Mittelpunkt steht.”
Im Mittelpunkt von ISOR stehen eine genaue fachärztlich-orthopädische und psychiatrische Diagnostik sowie spezielle orthopädische Trainingsmöglichkeiten. So können bestehende chronische orthopädische Schmerzsyndrome wie Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, Arthrose und chronische Schmerzstörungen mit psychischen und somatischen Faktoren adäquat und umfassend mitbehandelt werden. Gleichzeitig ist das Ziel, den Schmerzmittelkonsum zu reduzieren.
Der erste Weg geht zur Suchtberatung
Um diese umfangreiche Aufgabe zu schaffen, steht in der Klinik ein multiprofessionelles Team aus fünf Allgemeinmedizinern, Psychiatern und Orthopäden sowie fünf Physio- und Sportherapeuten zur Verfügung. „Wir können durch diese breite ärztliche und therapeutische Expertise vielen Menschen helfen, die oft eine Odyssee im Gesundheitssystem hinter sich haben”, schließt Dr. Bätje. Wer als Schmerzpatient bei sich eine Abhängigkeit vermutet, und eine Behandlung in Bad Essen antreten will, sollte zunächst den Weg in eine Suchtberatungsstelle suchen und gezielt nach der kombinierten Behandlung im ISOR-Programm fragen. In der Region um Bad Essen ist das Programm bereits an den entsprechenden Stellen bekannt und Patienten mit passenden zusätzlichen orthopädischen Befunden werden von dort direkt in die Klinik weitergeleitet.