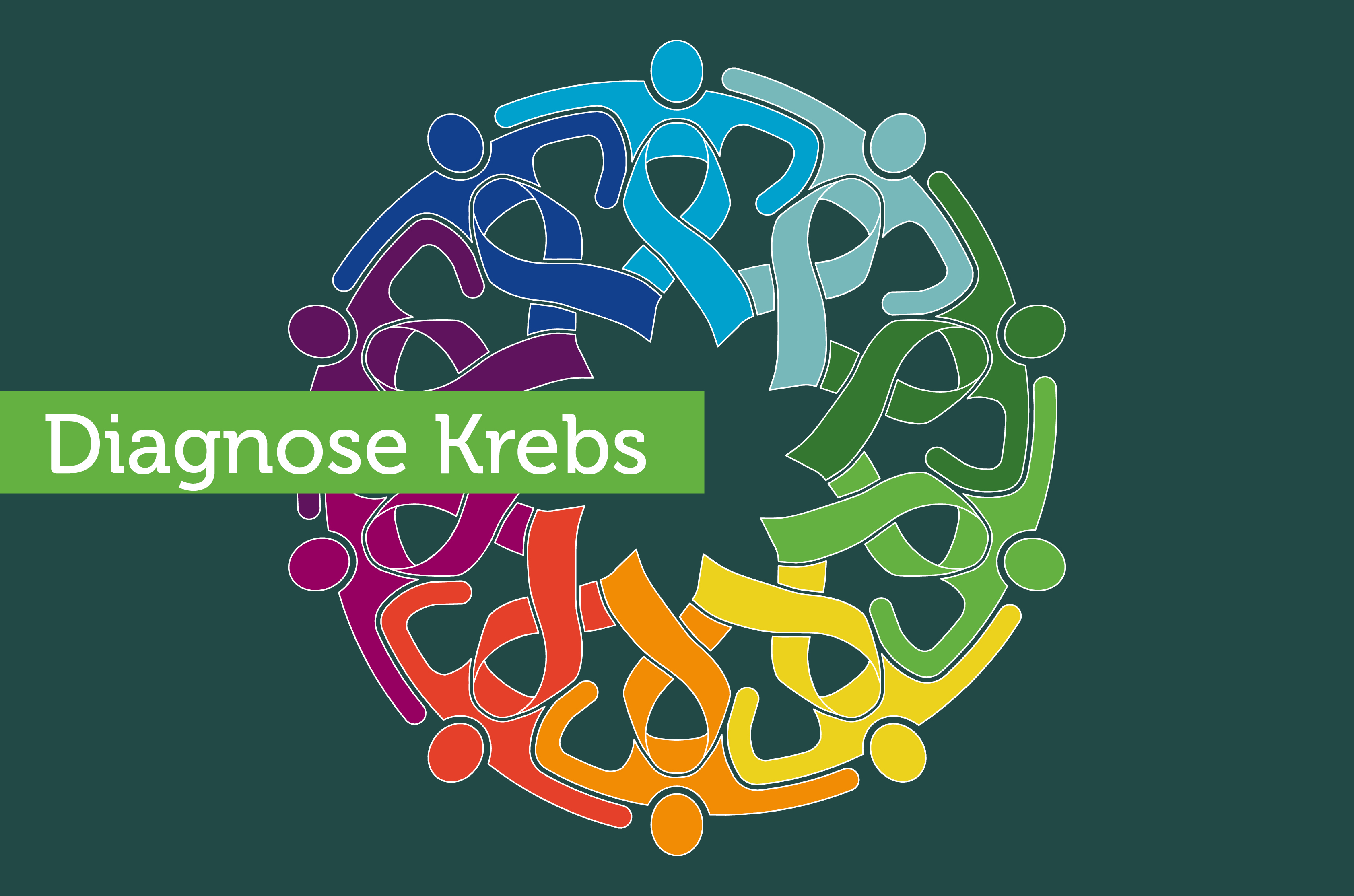Eine Hitzewelle kann gerade für ältere Menschen lebensgefährlich sein / Dr. Gabriele Goldschmidt, leitende Internistin der Inneren Medizin der Paracelsus Klinik Schöneck, gibt Ratschläge zum Verhalten bei Hitze
Noch sind Rekordwerte wie im Süden Europas nicht erreicht, aber schon hohe Temperaturen jenseits der 30 Grad, wie sie in den kommenden Tagen auch in Sachsen wieder erwartet werden, sind gerade für ältere Menschen gefährlich. „Bei Senioren ist das Durstempfinden häufig vermindert oder sie vergessen schlicht, ausreichend zu trinken”, weiß Dr. Gabriele Goldschmidt, leitende Internistin der Inneren Medizin der Paracelsus Klinik Schöneck. „Dabei ist der Flüssigkeitsbedarf bei Hitze deutlich größer, allein schon durch das Schwitzen. Wenn da nicht ausreichend getrunken wird, sinkt der Blutdruck bis hin zur Ohnmacht. Blutdrucksenkende oder wassertreibende Medikamente verstärken diesen Effekt noch.”
Das macht sich auch in der Notaufnahme der Klinik bemerkbar. Bei jeder Hitzewelle werden bis zu 50 Prozent mehr, vor allem ältere Menschen mit Kreislaufbeschwerden oder einem Hitzekollaps von den Rettungsdiensten eingeliefert. „Der Körper kommt durch die Hitze aus dem Gleichgewicht, reagiert zum Teil mit Fieber. Wir stabilisieren die Patienten dann zum Beispiel durch Flüssigkeitszufuhr über einen intravenösen Tropf, müssen aber in der Notaufnahme natürlich auch andere Krankheitsursachen überprüfen, um zum Beispiel einen Schlaganfall oder eine Infektion nicht zu übersehen”, so Dr. Goldschmidt. „Wenn Röntgen und Laborwerte unauffällig sind, werden die Patienten dann in der Regel zwei bis drei Tage später wieder aus dem Krankenhaus entlassen mit dem nachdrücklichen Hinweis, besonders auf das Trinken während einer Hitzewelle zu achten.”
Trinken ja, aber richtig und mit Vorsicht
Ausreichendes und regelmäßiges Trinken, da sind sich Experten einig, ist bei einer Hitzewelle überlebenswichtig. Aber: Alkoholhaltige oder eiskalte Getränke sind tabu. Denn Alkohol belastet den Organismus zusätzlich und kalte Getränke signalisieren dem Körper, zum Ausgleich extra Wärme zu produzieren. Besser geeignet sind darum Leitungswasser auf Zimmertemperatur, Kräuter- und Früchtetees ohne Zucker sowie Saftschorlen und Mineralwasser, möglichst auch elektrolythaltige Getränke, um die Nährstoffversorgung des Körpers sicherzustellen. Zwei bis drei Liter pro Tag sollten es sein, sofern keine medizinischen Gründe dagegensprechen. „Wir wissen, dass bei Menschen mit Herzerkrankungen, die Blutverdünner zu sich nehmen, Vorsicht geboten ist”, so Dr. Goldschmidt. „Das Wasser kann sich dann im Körper einlagern und das Herz braucht eine größere Pumpleistung. Wer schwer herzkrank ist, sollte deshalb unbedingt mit seinem Arzt Rücksprache halten, wie es sich verhalten soll.”
Hitze kann tödlich sein
In den drei Sommern 2018 bis 2020 sind allein in Deutschland mehr als 19.000 Menschen aufgrund der Hitze verstorben. Das zeigt eine Auswertung des Robert Koch-Instituts, des Deutschen Wetterdienstes und des Umweltbundesamts im „Deutschen Ärzteblatt“. In allen Regionen war die Altersgruppe der über 85-Jährigen am stärksten betroffen. Dabei ist Hitze als direkte Todesursache nur sehr selten. In der Regel verschärfen sich bestehende Erkrankungen des Kreislaufsystems und der Atemwege. „Bei hohen Temperaturen versucht der Körper durch eigene Regulationsmechanismen wie Schwitzen gegenzusteuern. Gelingt das nicht, reagiert er mit Fieber, um die Wärme abzugeben. Danach ist er mit seinen Möglichkeiten am Ende. Bestehen dann noch belastende Vorerkrankungen, wird es kritisch”, erklärt Dr. Goldschmidt. „Vorsicht ist insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung geboten. Dann nämlich können das Gehirn und der ganze Körper sehr schnell überhitzen – ein sogenannter Hitzschlag droht.” Wer sich längere Zeit ohne Kopfbedeckung der Sonne aussetzt, riskiert einen Wärmestau im Gehirn. Die Folgen: Das Hirngewebe kann anschwellen, es kommt zu Kopf- und Nackenschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Erbrechen. Im Extremfall kann es auch zu einem Hirnödem kommen, das zur Bewusstlosigkeit und sogar zum Tod führen kann. „Wer solche Symptome bei sich oder anderen wahrnimmt, sollte sofort die 112 anrufen”, rät Dr. Goldschmidt. „Ansonsten sollte man besonders als älterer Mensch die direkte Sonneneinstrahlung und körperliche Anstrengungen vermeiden, eine Kopfbedeckung und luftige, lange Baumwollkleidung tragen. Und nicht vergessen, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu verwenden, um die eigene Haut vor der UV-Strahlung und Verbrennungen zu schützen.”