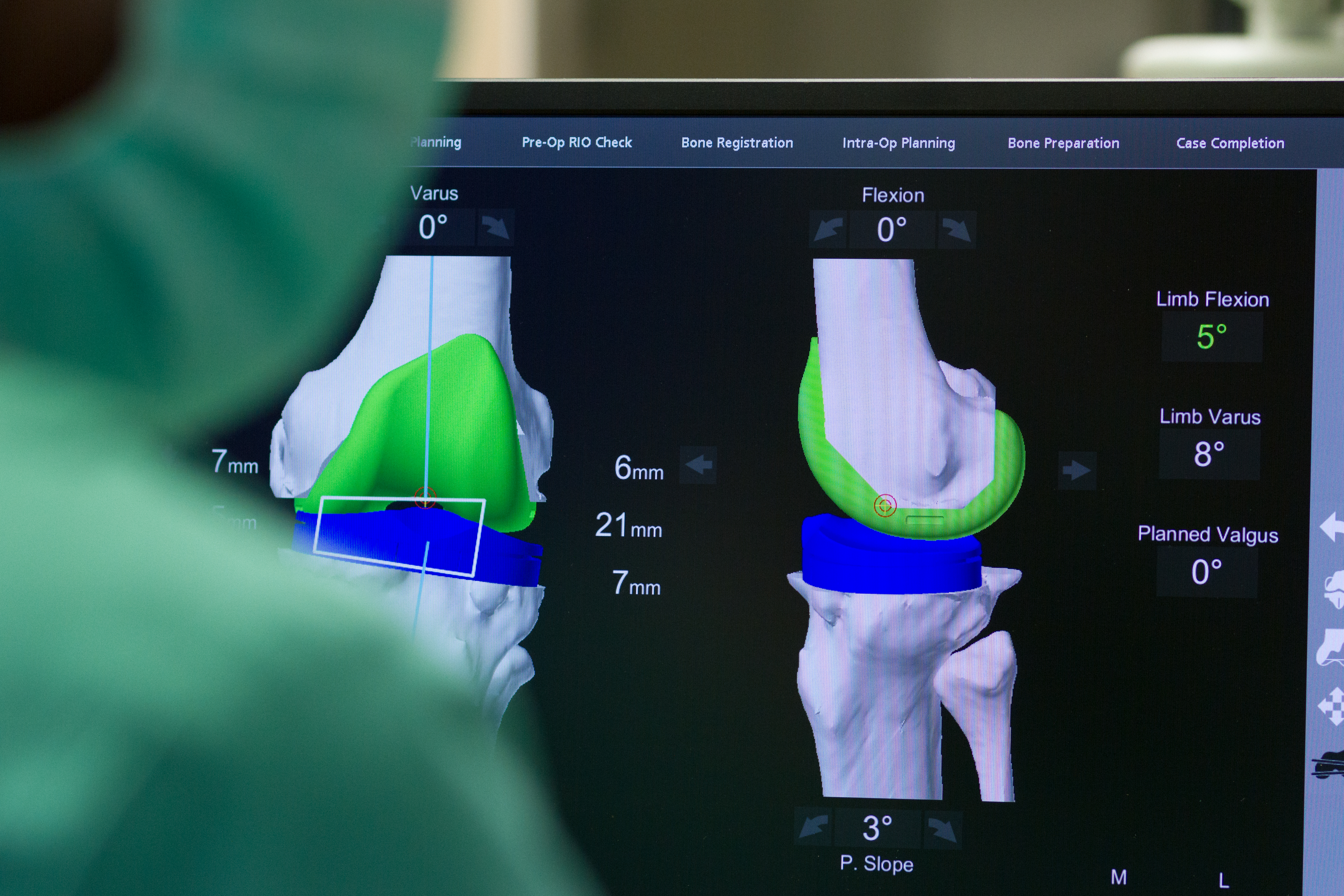Die Paracelsus-Kliniken optimieren mit einem neuen, hybriden Bürokonzept ihre Konzernzentrale
Ein offenes, digital vernetztes Großraumbüro mit flexibel buchbaren Arbeitsplätzen und Konferenzräumen, gemütlichen Gesprächs-Nischen für Teams, Stillarbeitsbereichen, Cafeteria, flexiblen Arbeitszeiten und Vielem mehr. Eine Zukunftsvision aus dem Silicon Valley? Nein, Realität bei den Paracelsus Kliniken in Osnabrück. Seit dem Jahreswechsel hat das Gesundheitsunternehmen seine neue Konzernzentrale bezogen mit einem völlig neu und hybrid ausgerichteten Bürokonzept. Hintergrund der ungewöhnlichen Idee ist eine neue Unternehmensphilosophie, die seit 2018 Schritt für Schritt Einzug in das Gesundheitsunternehmen gehalten hat. Damals erhielt der bundesweit aufgestellte Konzern mit seinen 34 Kliniken an 18 Standorten einen neuen Gesellschafter und mit ihm auch flache Hierarchien und ein offenes, auf Kommunikation ausgerichtetes Denken. „Das haben wir jetzt auch konsequent in die Arbeitsstrukturen unserer Zentrale übersetzt“, erklärt Arne Schönleiter, der die Abteilung Zentrale Dienste Bau und Gebäudemanagement bei Paracelsus leitet. Die Abteilung erhielt Anfang 2019 den Auftrag, ein neues Bürogebäude für die Hauptverwaltung des Klinik-Konzerns zu finden und dieses entlang der neuen Unternehmensphilosophie zu gestalten. Das Ziel: eine erhebliche Reduzierung der Fläche, möglichst viel Kommunikation und Verbesserung der Zusammenarbeit sowie die Schaffung moderner, flexibler und abwechslungsreicher Arbeitsstrukturen. Eine Aufgabe, die gut geplant sein wollte. Die Projektleitung für die neue Unternehmenszentrale übernahm Ira Rethschulte, langjährige Mitarbeiterin der zentralen Bauabteilung. Die 48-jährige Architektin, die sich eigentlich um die Klinik-Immobilien kümmert, brachte mit ihren fast 20 Jahren Erfahrung im Konzern die besten Voraussetzungen mit.
Den Bienenstock nachgebaut
„Wir arbeiten bei Paracelsus wie in einem Bienenstock“, erklärt die Architektin. „Viele Kollegen sind unterwegs in den Standorten – mobiles Arbeiten ist das Zauberwort. So sind manche Kollegen nur einen oder zwei Tage in der Woche im Büro, andere ständig. Nach unseren Schätzungen arbeiten die Mitarbeiter der Zentrale im Durchschnitt nur bis zu 60 Prozent fest an ihren Arbeitsplätzen. Das war ein wichtiger Ausgangspunkt unserer Optimierung.“ Rund ein Jahr dauerten die Planungsarbeiten für das neue Büro. Raumaufteilung, Raumnutzung, IT-Struktur, Möbel – alles musste neu konzipiert werden. Dabei ging es von Anfang an auch darum, die Beschäftigten in die Konzeption miteinzubeziehen. Das neue Büro sollte sowohl die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die „alten Hasen“ überzeugen, bei denen gerade am Anfang eine eher neutrale bis skeptische Grundeinstellung vorherrschte. „Da gab es viele Aspekte zu berücksichtigen“, berichtet Ira Rethschulte. „Manche Beschäftigten, wie z. B. aus der Personalabteilung, Buchhaltung oder Rechtsabteilung, brauchten einfach geschützte Arbeitsbereiche und Zugriff auf Dokumente in Papierform. Andere waren völlig flexibel und ihnen reichte eine Dockingstation für den Laptop.“ Es galt, eine Balance zu finden zwischen den Anforderungen der Geschäftsleitung und der Praxis. Dazu wurde aus jeder Abteilung ein Mitarbeiter direkt in die Planung einbezogen. Gleichzeitig mit den theoretischen Überlegungen ging Paracelsus daran, eine geeignete Bürofläche zu suchen. Schließlich fand sich ein geeignetes Mietobjekt im Gewerbegebiet am Hafen in Osnabrück, das als erweiterter Rohbau noch Gestaltungspotential in den inneren Strukturen bot. Das war Ende 2019.
Völlig neuer Anfang
Damit wurde die Planung deutlich konkreter. Von ehemals mehr als 2.700 Quadratmetern Fläche sollte das Büro auf jetzt 922 Quadratmeter – auf rund ein Drittel – reduziert werden. „Wir hatten vorher sehr viel Verkehrsfläche und sehr großzügige Büros, die auf große Mengen Papier ausgerichtet waren. Das braucht man heute alles nicht mehr“, erklärt Ira Rethschulte. Der Großteil der Dokumente wurde digitalisiert und archiviert, ein anderer Teil je nach Bedarf der Beschäftigten in entsprechenden Sideboards eingeplant. Zur Unterstützung engagierte Paracelsus in dieser Phase einen Innenarchitekten. Gleichzeitig wurde in enger Zusammenarbeit mit Büroausstattern nach dem optimalen Mobiliar gesucht. Schränke und Tische konnten zur Bemusterung von den Beschäftigten getestet werden. Farben, Lampen, Dekore, Tische für die Cafeteria – alles wurde gemeinsam ausgesucht. Und auch auf die Gesundheit wurde – wie könnte es in einem Gesundheitsunternehmen anders sein – geachtet. So wurde zum Beispiel mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen auf Ergonomie für entspanntes Arbeiten geachtet. „Zusammen mit dem Innenarchitekten haben wir Schritt für Schritt ein tolles Konzept entwickelt, das vielen Ansprüchen gerecht wird“, berichtet Ira Rethschulte, die bei Konzept, Umbau und Umzug die Fäden in der Hand hielt.
Bürolandschaft für flexibles Arbeiten
Und so sieht die Lösung aus, die Mitte Dezember 2020 bezogen wurde und zum Jahresbeginn an den Start ging: ein Großraumbüro über zwei Etagen mit offenen Schreibtischplätzen und buchbaren ruhigeren Einzelbüros. Das Gros der Arbeitsplätze ist in Zweier- und Dreiergruppen an den Fensterseiten mit Tageslicht ausgerichtet. Im mittleren Bereich ist eine „Quiet area“ mit Sitznischen eingerichtet, die Gespräche für bis zu sechsPersonen in kleiner Runde möglich machen. Insgesamt 48 Arbeitsplätze stehen den rund 60 Beschäftigten der Zentrale zur Verfügung. Das reicht aus – inklusive einer flexiblen Reserve –, weil nicht jeder Mitarbeiter jeden Tag einen Schreibtisch braucht. „Das ist mit dem klassischen amerikanischen Großraumbüro, in dem es für jeden Mitarbeiter eine Box mit Schallschutztrennwänden gibt, überhaupt nicht vergleichbar“, beschreibt Ira Rethschulte. „Bei uns hat prinzipiell jeder die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Niemand hat einen Anspruch auf einen bestimmten Schreibtisch und es gibt keine Hierarchie. Das Miteinander auf Augenhöhe im Alltag, das wir in unserem Unternehmen pflegen, soll sich so auch am Arbeitsplatz widerspiegeln.“ Was im Alltag allerdings respektiert wird, ist eine Schwerpunktbildung innerhalb der Bürofläche, die den bisherigen Abteilungen entspricht. Bau, Buchhaltung und Controlling sind eher im unteren Geschoss tätig, Personal, IT, Recht und Geschäftsführung eher im oberen Geschoss. „Das optimierte Zusammenspiel ergibt sich von allein, ausgerichtet an den Aufgaben“, erklärt die Architektin. „Aber es ist sicher auch der eine oder andere dabei, der sich schon so an seinen Arbeitsplatz gewöhnt hat, dass er ihn regelmäßig aufsucht.“
Im ganzen Büro herrscht übrigens das Clean-Desk-Prinzip. Das heißt, der Arbeitsplatz sollte aufgeräumt verlassen werden, so dass er vom nächsten wieder uneingeschränkt genutzt werden kann. Für persönliche Unterlagen gibt es zentral eingerichtete abschließbare Fächer und einen Informations-Hub. Dieser ersetzt aufgrund der stetig zunehmenden Papierlosigkeit im Alltag herkömmliche Postfächer.
Digital und kommunikativ durchdacht
Eine ganz besondere Herausforderung war die IT-Konzeption des Komplexes. Jeder Arbeitsplatz innerhalb des Büros hat im Endausbau eine Dockingstation mit Monitor, Tastatur und Maus. Damit kann jeder Mitarbeiter sich mit seinem Laptop und wenigen Handgriffen einen Arbeitsplatz einrichten. Selbst mitgebracht werden muss darüber hinaus nur das eigene Headset, idealerweise Over-Ear, um ungestört telefonieren zu können. Damit das bei 60 Mitarbeitern funktioniert und alle jederzeit auf die IT-Strukturen und Peripheriegeräte zurückgreifen können, wird eine umfangreiche Verkabelung und Vernetzung mit eigener Serverstruktur und ein leistungsfähiges WLAN gebraucht. „Eine Meisterleistung unserer IT-Abteilung“, lobt Ira Rethschulte.
Das Zusammenspiel von Technik, Architektur und durchdachten Arbeitsabläufen bringt Paracelsus dem Ziel seiner Unternehmensphilosophie sehr viel näher. „Wir wollen das Arbeiten in dieser Bürofläche so abwechslungsreich und mobil wie möglich gestalten“, erklärt Ira Rethschulte. „Man kann sich immer wieder mit unterschiedlichen Teams an unterschiedlichen Orten zusammensetzen. Kein Raum bleibt ungenutzt liegen. Der klassische Besprechungsraum, der nur einmal mit Monat von der Geschäftsführung genutzt wird, ist passé.“ Konferenzräume sind jetzt für alle da und können jederzeit variabel gebucht werden – ob für Besprechungen oder Videokonferenzen. Und wer will, kann sich auch vom eigenen Home-Office oder aus den Standorten von Paracelsus direkt zur Besprechung mit den Kollegen einloggen.
Arbeiten und leben kombiniert
Variabel präsentiert sich auch die große Cafeteria im Obergeschoss. Als traditioneller Dreh- und Angelpunkt jeden Büros sorgt eine Kaffeemaschine hier für angenehme Pausen und auch das Mittagessen lässt sich dort mit prickelndem Getränk aus dem beliebten Trinkwassersprudler komfortabel einnehmen. „Wir wissen, dass viele Kollegen auch gerade in den Pausen und beim Essen noch Arbeitsthemen besprechen“, verrät Ira Rethschulte. „Darum gibt es auch in der Cafeteria zusätzlich zu dem überall vorhandenen WLAN auch Anschlüsse für den Laptop und eine Besprechungsecke – quasi als Softworking-Place.“ Genauso verhält es sich mit der angeschlossenen Terrasse. Eine Glasfront mit Schiebetüren gibt den Weg frei und lädt zum Arbeiten ebenso wie zur Entspannung an der frischen Luft ein. Hier pflegt Paracelsus auch ein Stück weit Feierabend-Kultur, denn mit Blick über Osnabrück lässt sich dort abends auch der Grill zum kollegialen Tagesausklang starten. „Dass wir im Kollegenkreis auch nach Feierabend noch beisammenstehen können und hin und wieder auch den Grill anschmeißen, prägt unser Miteinander im Team deutlich und macht die Kommunikation und das Miteinander arbeiten viel persönlicher – quer durch alle Abteilungen“, beschreibt Ira Rethschulte die Wirkung dieser eher informellen Teambuilding-Prozesse.
Neue Arbeitsatmosphäre kommt gut an
Und die Bilanz nach einem halben Jahr Büro-Praxis? Bei Ira Rethschulte sind bisher nur positive Rückmeldungen aus der Belegschaft eingegangen. „Ja, es gab natürlich einige Nachbesserungen“, erklärt die Architektin. „Aber die konnten wir schnell erledigen. Gerade die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen die Flexibilität des Büros gern und freuen sich über mehr Kontakte und die Möglichkeit sehr schnell die Kollegen kennenzulernen.“ Das eine oder andere schleife sich aber auch gerade noch ein, sagt sie. Manche Kollegen müssten sich z. B. noch daran gewöhnen, für ein vertrauliches Telefonat in ein ruhiges Einzelbüro zu wechseln statt dies im Großraum zu führen. „Ich glaube, dass es uns insgesamt gut gelungen ist, die Philosophie von Paracelsus in diesem Büro umzusetzen“, ist Ira Rethschulte überzeugt. „Die Teams wachsen hier zusammen, man lernt die Arbeit seiner Kollegen schätzen und wird vom Spirit der Paracelsus Gesundheitsfamilie richtig mitgezogen.“ Projektleitung: Ira Rethschulte, ZD Bau & Gebäudemanagement, Paracelsus Kliniken Deutschland Innenarchitekt: Büro Ruge & Göllner, Vechta