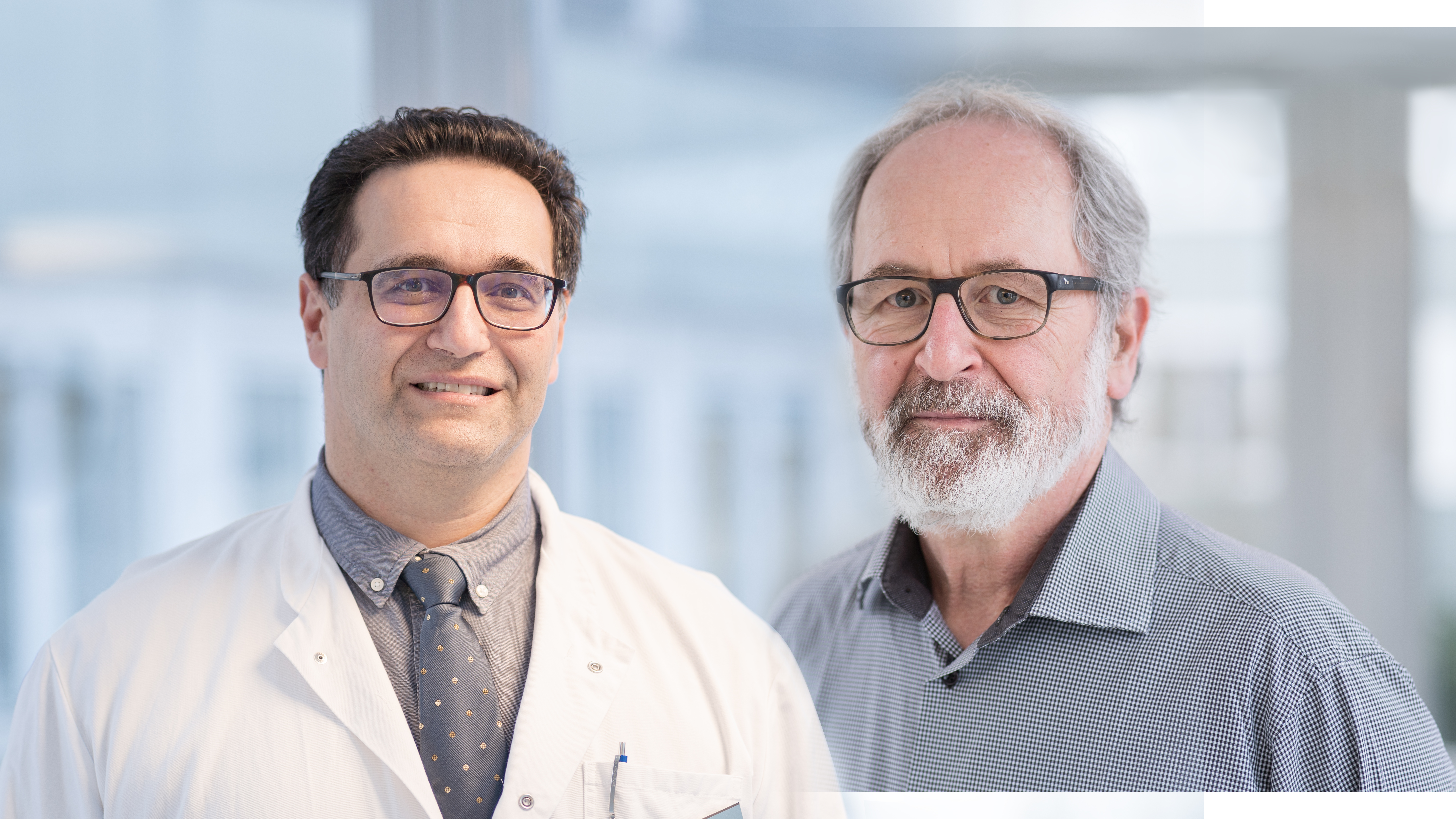Dauerhaft eine Alkoholsucht oder eine Medikamentenabhängigkeit zu überwinden und ein Leben jenseits der Sucht zu führen, ist für die Betroffenen ein langer Weg. Herr und Frau K. sind diesen Weg gegangen. Beide haben nach einer stationären Entwöhnungsbehandlung und einer darauf aufbauenden Adaptionsmaßnahme in den Bad Essener Suchtfachkliniken die Wende in ihrem Leben geschafft.
Adaption als Brücke aus der Sucht
Eine Adaptionsmaßnahme unterstützt Suchtpatienten dabei, sich ein stabiles Lebens- und Arbeitsumfeld aufzubauen. In der Paracelsus Berghofklinik II können Betroffene gut begleitet ihren Weg aus der Sucht heraus weiter beschreiten.
Der Übergang von einer stationären Entwöhnungsbehandlung in das berufliche und gesellschaftliche Leben ist nicht immer leicht. Die Ablösung aus dem Klinikumfeld kann Leistungsdruck, Angst vor Versagen oder auch Angst vor sozialen Konflikten auslösen. und mit erhöhter Rückfallgefahr verbunden sein. Eine Adaptionsmaßnahme bietet die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen den Therapieerfolg unter realen Alltagsbedingungen zu verfestigen und den Übergang in einen suchtmittelfreien Alltag zu bewältigen. Neben der langfristigen Festigung der erreichten Abstinenz ermöglicht die Adaptionsphase mit berufsfördernden und ergänzenden Maßnahmen den Aufbau eines stabilen Lebens- und Arbeitsumfeldes.
Während der Adaptionsmaßnahme orientieren sich die Behandlungs- und Beratungsangebote am individuellen Gesundheitszustand der Patienten und werden auf die persönlichen Bedürfnisse hin ausgerichtet. Im Fokus steht die Förderung sozialer Kontakte und eigener Aktivitäten für eine selbstständige Lebensführung. Übergeordnetes Ziel ist immer die Abkehr von der Sucht, um so die Wende für das eigene Leben zu schaffen. Mögliche Behandlungsangebote während der Therapiezeit sind
- Einzel- und Gruppentherapien
- Sozialtherapeutische Unterstützungsangebote im Hinblick auf Bewerbungen und Vorstellungsgespräche sowie der alltäglichen Haushaltsführung und
- Ergo- und Arbeitstherapieangebote
Schritt für Schritt den Alltag üben
Die Therapiezeit in der Adaption lässt sich grob in drei Phasen unterteilen: Eingewöhnung, Berufspraktikum mit Wohnungssuche sowie letztendlich die Ablösung.
In den ersten Wochen liegt der Fokus auf der Eingewöhnung in der neuen Wohnumgebung und der Einleitung der zukünftig eigenständigen Lebensführung. Dabei ist die Praktikums- bzw. Arbeitsplatzsuche für eine finanzielle Absicherung ein dominantes Thema. Aber auch die Planung der Tagesstruktur und eine regelmäßige Haushaltsführung sind wichtige Themen, die nach jahrelanger Sucht erlernt werden müssen.
Arbeit, Wohnen, Hobbies
In der zweiten Phase folgt ein mindestens sechswöchiges halb- bis ganztägiges Praktikum in einem Betrieb in der Nähe der Adaptionseinrichtung. Das Praktikum soll helfen, neue berufliche Perspektiven zu entwickeln, die nach Jahren der Alkoholsucht oder Tablettenabhängigkeit verloren gegangen sind. Eigene Stärken und Schwächen können erarbeitet und individuelle Indikatoren für An- oder Überforderung ermittelt werden. Zeitgleich rückt die aktive Wohnungssuche als zweiter Pfeiler in den Vordergrund. Fragen wie „Wo will ich wohnen?“, „Wie will ich wohnen?“ oder „Welche Hobbies möchte ich von dort ausüben können?“ werden in gemeinsamen therapeutischen Gesprächen beantwortet, um die individuellen Ziele und Vorstellung der Patienten zu reflektieren und zu definieren.
Zum Ende der Adaptionsphase folgt dann die aktive Ablösung aus der Einrichtung. Damit verbunden ist der Beginn einer vollständigen Eigenständigkeit. Wichtige Themen sind dann z.B. die Wohnungssuche mit einem erfolgreichen Abschluss, die verstärkte Arbeitsplatzsuche für eine geregelte Tätigkeit nach der Adaptionsmaßnahme oder auch die Kontaktaufnahme zu Selbsthilfegruppen im neuen Wohnumfeld.
Antragstellung für eine Adaption
Voraussetzung für den erfolgreichen Start in eine Adaptionsphase ist eine vorausgehende stationäre Entwöhnungsbehandlung, die regulär abgeschlossen wurde. Der Übergang erfolgt nahtlos. Die Antragsstellung übernimmt der jeweilige Sozialdienst in der stationären Entwöhnungsklinik ca. vier Wochen vor Beendigung der Maßnahme. Häufig ist zusätzlich eine schriftliche Bewerbung und ein Motivationsschreiben des Patienten an die Einrichtung nötig.
Zwei, die es geschafft haben, der Sucht den Rücken zu kehren
Aber zurück zu Herrn und Frau K., die als Patienten der Adaptionseinrichtung in Bad Essen ihren Weg aus Alkoholsucht und Medikamentenabhängigkeit geschafft haben: Beide haben nach einer stationären Entwöhnungsbehandlung eine mehrmonatige Adaptionsmaßnahme in der Paracelsus-Berghofklinik II hinter sich. Für Herrn K. wurde mit der Therapie klar, dass eine räumliche und berufliche Neuorientierung stattfinden musste, damit sein Weg in ein zufriedenes Leben jenseits der Sucht gelingen kann. „Ich bin gelernter Tischler, habe studiert und 15 Jahre Berufserfahrung. Mein Job hat mit dazu beigetragen, dass ich in Bad Essen gelandet bin.“ Die Adaptionsmaßnahme habe ihm das Gefühl zurückgegeben, wieder allein seinen Tag gestalten und normal leben zu können, wohlwissend um die begleitende Unterstützung der Therapeuten vor Ort.
Vom Praktikanten zum Gruppenleiter
Sein erstes Praktikum absolvierte er in einer Tischlerei, in der Herr K. heute fest angestellt ist und als Gruppenleiter arbeitet. „Das war von Anfang an meine Traumstelle. Also habe ich nach dem Praktikum nie den Kontakt zum Arbeitgeber verloren und bin drangeblieben. Mit Erfolg!“, freut sich Herr K. über seine berufliche Entwicklung. Frau K. fügt ergänzend hinzu: „Es ist einfach schön zu sehen, wie viel Spaß und Freude er heute wieder an seiner Arbeit hat!“. Aber auch mit Rückschlägen musste er umgehen. Nach einem Rückfall suchte sich Herr K. jedoch sofort Hilfe, um seinen Weg wieder zu finden. „Die Zeit war schwierig und anstrengend, aber ich wollte meinen Weg wieder zurückfinden. Wichtig war, sich darauf einzulassen!“, resümiert er die Zeit nach dem Rückfall.
Assistenzhund als Begleiter
Der Weg in die Adaption erfolgte für Frau K. auf Rat ihres Therapeuten nach der zweiten stationären Therapie. „Bei meiner ersten Therapie war mir nicht klar, warum ich aufhören soll. Erst die zweite Therapie brachte Klarheit über meine Sucht“, erklärt sie ihren Entwicklungsprozess. Nach der Adaption folgte die Vorbereitung auf die Wiedereingliederung über das Arbeitsamt. „Mein eigener Anspruch war sehr hoch. Ich wollte möglichst viel für mich rausziehen, wodurch ich mich unglaublich unter Druck gesetzt habe“, beschreibt Frau K. die Zeit nach der Therapie. Starke Erschöpfungssymptome mit Panikattacken und Ängsten, die sie noch heute manchmal übermannen, sowie ein mehrwöchiger Klinikaufenthalt waren die Folge. Seit April diesen Jahres ist die gelernte Architektin beim Arbeitgeber ihres Partners angestellt. „Ich zeichne und kalkuliere Küchen, kümmere mich um die Akquise und die Büroarbeit.“
Um im Alltag besser mit ihren Panikattacken und Ängsten umgehen zu können, unterstützt Frau K. seit gut 8 Monaten eine weiße Schäferhündin als Assistenzhund. „Sie begleitet und unterstützt mich, wenn die Ängste wieder stärker werden, allein vor die Tür zu gehen. Wir haben eine sehr starke Bindung zueinander aufgebaut. Regelmäßige Trainingsstunden unterstützen uns hierbei.“ Rückblickend steht für Frau K. fest: „Durch die Therapie habe ich meine Lebensqualität wiedergefunden, spüre wieder richtige Freude und habe die Erkenntnis gewonnen, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben.“
Den Alltag jenseits der Sucht zu zweit meistern
Heute, rund drei Jahre später, bilden Herr und Frau K. quasi ihre private Therapiegruppe zu zweit. Die beiden hatten sich nämlich zum Ende ihrer Therapien als Paar gefunden, seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. „Es ist herausfordernd und schwierig zugleich, aber auch ein tolles Miteinander. Wir stützen uns gegenseitig. Unser Credo: Kommunikation und reden ist wichtig!“, sind sich beide einig.