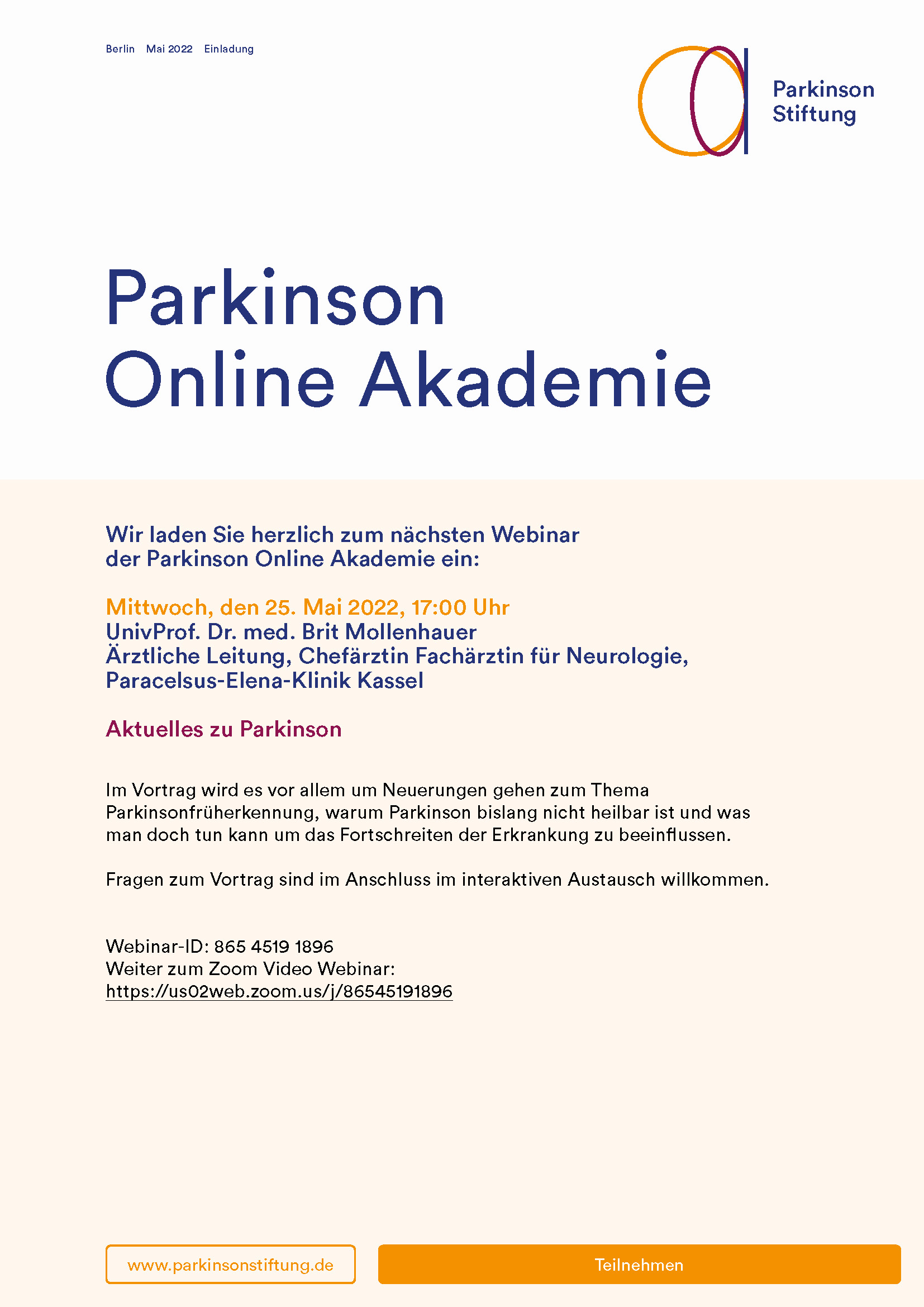Univ.-Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Leiterin des Kompetenznetzwerks Parkinson bei den Paracelsus-Kliniken, gehört im Bereich Schlafmedizin und Morbus Parkinson zu den Top-Medizinern in ganz Deutschland
25.05.2022. Die Neurologin Univ.-Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, ehemalige Chefärztin und ärztliche Leiterin der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel, gehört auch 2022 im Bereich der Fachgebiete Schlafmedizin und Morbus Parkinson zu den Top-Medizinern in ganz Deutschland. Im neuen FOCUS Gesundheit 4/2022 steht die Leiterin des Kompetenznetzwerkes Parkinson bei Paracelsus auf der bundesweiten Bestenliste von 16 Expertinnen und Experten für Schlafmedizin und gehört zu den 54 herausragenden Ärzten für Morbus Parkinson. Die 62-Jährige ist damit eine der renommiertesten Neurologinnen Deutschlands. Bei der Bewertung durch den FOCUS ragt besonders die Reputation von Dr. Trenkwalder hervor, die Bestnoten sowohl bei der Empfehlung von Kollegen als auch bei der Patientenbewertung umfasst.
Erfahren in Behandlung und Forschung
Als ausgewiesene Expertin für Morbus Parkinson und andere Bewegungsstörungen ist Prof. Dr. Trenkwalder bereits seit Jahren auf der FOCUS-Ärzteliste vertreten. Die gebürtige Augsburgerin studierte von 1979 bis 1986 Humanmedizin an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München, wo sie auch 1986 promovierte. Die Facharztausbildung absolvierte sie von 1988 bis 1993 an der Neurologischen Universitätsklinik in München Großhadern und wechselte danach als Oberärztin für Neurologie an das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA habilitierte sie 1997 über das Restless-Legs-Syndrom. Sie ist Gründungsmitglied der World Association of Sleep Medicine und der European RLS Study Group und hat die Deutsche Restless Legs Vereinigung gegründet. 2000 wechselte sie an die Klinik für Klinische Neurophysiologie an der Universitätsmedizin Göttingen und von 2003 bis 2022 war sie Chefärztin der Paracelsus-Elena-Klinik Kassel, einer neurologischen Akutklinik und Spezialklinik für Parkinson-Syndrome und Bewegungsstörungen. Auf internationalem Parkett war Prof. Trenkwalder von 2019 bis 2021 erste Frau als Präsidentin der Internationalen Parkinson und Movement Disorder Society und ist aktuell deren Past-President. An der Klinik bietet sie derzeit weiterhin Online-Sprechstunden an und verfolgt ihr großes Ziel, eine Online-Klinik für Parkinson zu initiieren. Univ.-Prof. Trenkwalder ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.
Kollegen beurteilen Kollegen
Aufgrund ihrer positiven Bewertung sind in diesem Jahr rund 4.155 Ärzte in Deutschland in 122 Fachgebieten qualifiziert, das Focus-Gesundheits-Siegel „Top-Mediziner 2022“ zu tragen. Die Empfehlungen basieren auf einer Erhebung des Rechercheinstituts FactField. In sie fließen rund 400.000 in Deutschland niedergelassene Ärzte und Klinikärzte ein, von denen 75.000 in die erste Auswahlrunde des FOCUS kommen, wo sie hinsichtlich Facharztqualifikation, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Online-Bewertungen und Weiterbildungen gecheckt werden. Jeder der 30.000 Ärztinnen und Ärzte, die dann in die nächste Runde kommen, nimmt an einer Befragung zur Selbstauskunft teil und wird gebeten, Mediziner-Kollegen zu empfehlen. Dieses sogenannte Peer-Review gilt in der Wissenschaft als besonders zuverlässige Methode. Neben der Reputation im Kollegenkreis erfassen die Rechercheure weitere Kriterien, die die medizinische Qualität eines Arztes widerspiegeln. Dazu gehören etwa die Teilnahme an wissenschaftlichen Studien oder Bewertungen von Patientenverbänden und regionalen Selbsthilfegruppen. Die Ärzte sind nach Postleitzahlen geordnet. Außerdem macht das Magazin auch Angaben zur Spezialisierung, dem Behandlungsspektrum sowie zu den Kontaktmöglichkeiten.